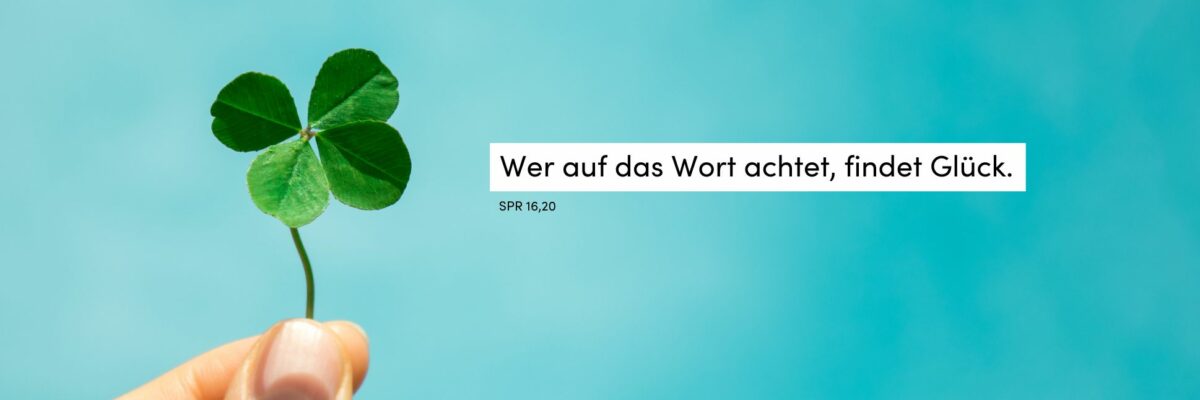Frage der Bewertung des Handelns von Bischof Wilhelm Berning

Das Handeln von Bischof Wilhelm Berning (1877 bis 1955) in der Zeit des Nationalsozialismus ist umstritten. Immer wieder wird über das öffentliche Gedenken an ihn, der von 1914 bis 1955 Bischof von Osnabrück war, diskutiert. Anbei eine Einordnung von Bischof Dominicus Meier dazu.
Bischof Wilhelm Berning trat sein Amt zu Beginn des Ersten Weltkriegs an und war in den Kriegsjahren darum bemüht, die Vaterlandstreue der Katholiken seines Bistums abzusichern und teils mit kriegstreiberischer Rhetorik nach außen zu demonstrieren. In der Weimarer Republik positionierte er sich sodann öffentlich gegen extreme politische Kräfte von links und rechts und gehörte zu diesem Zeitpunkt selbst dem Zentrum an. Er erwies sich als dynamischer Oberhirte, der die kirchliche Infrastruktur im deutschen Nordwesten nachhaltig erweiterte.
Von 1933 bis zur Jahresmitte 1934 ging Bischof Berning davon aus, dass Adolf Hitler auf christliche Werte baue und die Kirche stärken werde. Auf dieser Basis stimmte er die Diözese auf einen Annäherungskurs ein, dessen große Wirksamkeit sich in den polizeilichen und ordnungsbehördlichen Lageberichten aus Osnabrück spiegelt. In der Silvesterpredigt zum Jahresausklang 1933 appellierte er an die Gläubigen, der neuen Zeit die ewige Lampe Christi voranzutragen, sich echten irdischen Lebens- und Kulturwerten gegenüber aufgeschlossen zu zeigen sowie am Volkstum und Gemeinwohl mitzuwirken: „So wollen wir treu zur Kirche stehen, zu der alten Kirche in neuer Zeit.“ Das Führerprinzip entspreche dem Leitungsprinzip der Kirche mit dem Papst als Stellvertreter Christi und unbedingten Führer, der lediglich Gott und seinem Gewissen verantwortlich sei. Auch der „Führer unseres Staates“ bekenne sich zu seiner Verantwortung vor Gott und seiner Hingabe an das Volk und sei in Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam als staatliche Autorität anzuerkennen. Das neue Reich habe in den ersten zehn Monaten „Vieles und Großes“ geschaffen, indem es kraftvoll die Kräfte des Umsturzes und der Gottlosigkeit niedergerungen, das Volk vor dem Chaos des Bolschewismus bewahrt, die „furchtbare Arbeitslosigkeit“ eingedämmt und nach der Phase der Partei- und Klassenkämpfe das Volk nach außen und innen geeint habe, wie das Winterhilfswerk belege. Zum Wohl des Volkes gewährleiste das Konkordat als große Tat des Friedens ein harmonisches Zusammenwirken zwischen Staat und Kirche, das durch unberufene und unverantwortliche Kräfte nicht gestört werden dürfe.
Der Bischof wurde Preußischer Staatsrat, wirkte maßgeblich am Konkordat mit dem Vatikan mit und bemühte sich das katholische Milieu absichern, zu dessen Kernelementen die konfessionellen Schulen und die katholischen Verbände gehörten. Die fatalen Folgen dieses frühen Kurses beschreibt der im Mai 1935 aus Hamburg über Osnabrück, die Niederlande, England und die Schweiz in die USA geflohene Leiter der katholischen Seemannsmission und Seemannspastor Hans Ansgar Reinhold in seinen autobiografischen Aufzeichnungen: „Mein Bischof, Wilhelm Berning, war […] kein Nazi, aber er sympathisierte mit der Bewegung. Entweder glaubte er die Berichte von Naziterror und Gräueltaten nicht, oder er sah sie als bedauerliche Entgleisungen im ersten Rausch der Revolution an. Er sah im Nationalsozialismus eine jugendliche Kraft der Erneuerung in Deutschland, eine große völkische Woge, auf deren Kamm die Kirche reiten würde. […] Er war stark beeinflußt von den Ehrungen, die er erfuhr und merkte nicht, dass er von ihnen getäuscht wurde. Er besaß einen aufrichtigen Charakter, wenn auch ein guter Teil moralischer Naivität vorhanden war. […] Die Unterzeichnung dieses Konkordates beendete alle Hoffnung des katholischen Widerstands in Deutschland auf eine gemeinsame Opposition gegen Hitler.“
Seit Mitte des Jahres 1934 durchschaute Wilhelm Berning zusehends die wahren Absichten des Regimes, das ihn im Gegenzug als Staatsfeind einstufte. Die nun forcierte Katholische Aktion mied zwar politische Kontroversen und konzentrierte sich zugleich aber auf unanfechtbare geistliche Aktivitäten: Inszenatorische Parallelen zu propagandistischen Parteiaktionen machten Prozessionen, Wallfahrten, das Ewige Gebet, Bekenntnissonntage und andere Aktivitäten zu einer gefährlichen Konkurrenz für die Machthaber. Ernüchtert räumte der Bischof in seiner reichsweit kontrovers aufgenommenen Silvesterpredigt 1934 ein, wie trügerisch seine Hoffnung auf die staatliche Belebung christlicher Werte und die Stärkung der Kirche gewesen sei. Eigenwillige und verblendete, aber gleichwohl einflussreiche Menschen missbrauchten die nationale Bewegung für einen Sturmangriff auf Christentum und Kirche. Alle Vereine für Jugend- und Erwachsenenbildung seien im neuen Jahr gefordert, diesen Kampf der Gegenwart mit den Waffen des Glaubens zu führen: „Keine Schmähung gegen Personen, keine Verhetzung der Volksmassen, sondern klare Schulung und Schärfung des Geistes, Stärkung des Willens, nicht zuletzt Festigung des Vertrauens auf Gottes Gnade.“ Dabei bahne das ewige Gebet „dem eucharistischen König Jesus Christus den Weg in die Gemeinden und in die Herzen der Gläubigen“.
In diesem Sinn forcierte der Bischof die Christus-König-Verehrung als geistlichen Gegenentwurf zum ungerechten NS-Regime und stellte die von der Domgemeinde abgepfarrte, 1933/34 von A. Feldwisch-Drentrup erbaute Kirche in Haste unter das Patrozinium des himmlischen Herrschers: weithin sichtbar durch die von Jakob Holtmann geschaffene, überlebensgroße Christus-König-Statue an der Westfassade. Gleichwohl richtete der Bischof während der Konsekrationsfeierlichkeiten im Saal Osterhaus noch immer Ergebenheitsadressen an den Führer und beendete seine Rede mit einem Hoch auf den Papst und einem dreifachen „Sieg Heil“ auf Hitler.
In den späten 1930er Jahren verlor der Bischof den politischen Kampf um die katholischen Schulen, und im Bombenhagel der letzten Kriegsjahre fiel die enorme infrastrukturelle Aufbauleistung des Bistums vielerorts in Schutt und Asche. Nach dem Krieg knüpfte der Bischof sodann an alte Ziele und Stereotypen wie die Wiedererrichtung konfessioneller Schulen oder den Antibolschewismus an, ohne öffentlich selbstkritisch eigenes Versagen zu thematisieren. Den Zeitgenossen galt er teils sogar gemeinsam mit dem Münsteraner Bischof Clemens August von Galen als Widerständler gegen das Regime.
Bewertung
Das Bistum Osnabrück hat nach der Jahrtausendwende sowohl die engen Grenzen der politischen Intuition Bischof Bernings als auch seine enorme Tatkraft öffentlich thematisiert und sich dabei bemüht, die Fakten über sein gesamtes bischöfliches Tun objektiv aufzuzeigen und diese im zweiten Schritt in ihrer Ambivalenz zu bewerten.
Der Diskurs um Straßennamen und anderes öffentliches Gedenken schärft den öffentlichen Blick für derlei Ambivalenzen und verhindert ein Vergessen der Zusammenhänge. Aus diesem Grund betreibt das Bistum mit erheblichem Aufwand drei Wanderausstellungen, in denen die eigene Verstrickung in das NS-Zwangsarbeitssystem, die Gleichschaltung der pluralen Jugend- und Sportarbeit sowie die Ermordung der „Lübecker Märtyrer“ und ihre Hintergründe thematisiert werden. Dabei wurde stets die schwierige Bewertung Wilhelm Bernings offen angesprochen.
Die historische Vermittlung ging und geht dabei davon aus, dass vor allem der öffentliche Diskurs ein nachhaltiges Problembewusstsein fördert. Ob Straßennamen in diesem Kontext geändert werden sollten, ist vor allem in die Entscheidung kommunaler Gremien gestellt.
Dominicus Meier OSB
Bischof von Osnabrück im April 2025