Religion ist kein Gefrierschrank

Trauer um Papst Franziskus. Mich bewegen die Bilder mit den langen Schlangen der Menschen, die im Petersdom von ihm Abschied nehmen. Viele werden Gesicht und Gesten dieses zugewandten, warmherzigen Papstes in ihren Herzen bewahren. Für mich war er ein Papst, der im Alltag zuhause war.
Ob saure Gurken oder Kühlschränke – gerne zog er Vergleiche aus dem ganz normalen Leben heran. Viel zitiert sind die kraftvollen Bilder von der verbeulten und verschmutzten Kirche, der Kirche mit Unfallrisiko und dem Feldlazarett. Daneben hat sich mir ein Wort besonders eingeprägt: Wahre Religion sei „kein Gefrierschrank“. Das betont er in seinem Buch „Wage zu träumen“ aus dem ersten Coronajahr.
Unvergessen bleibt der einsame Papst, der während des Lockdowns auf dem menschenleeren Petersplatz den Segen mit dem alten Pestkreuz spendet. Schon allein das ist unglaublich mutig: Inmitten einer tiefen weltweiten Krise träumt der Papst von einer besseren Zukunft und lädt ein, mit ihm zusammen zu träumen. Dabei ist er alles andere als ein Illusionär. Vielmehr fordert er zu konkretem Handeln auf, etwa im Blick auf einen nachhaltigeren Lebensstil.
Er warnt vor einer Gefrierschrank-Religion, in der religiöse Traditionen und Überzeugungen wie Gefriergut lange ruhen, bis es bei Bedarf aufgetaut wird. Wer mag sich schon auf Dauer von TK-Kost ernähren. Die Tradition, die Weitergabe des Glaubens sei kein Museum, in dem man alte Schätze aufbewahrt und von Zeit zu Zeit neu aufpoliert. Papst Franziskus war zurückhaltend, selbst die kirchliche Lehre zu verändern. Aber eines ist unübersehbar: Eine große Offenheit für Reformen, Weiterentwicklungen und ein neues Verstehen der Glaubensüberzeugungen und kirchlichen Lehraussagen durchzieht alle seine Schriften. So verbindet er mit dem Bild vom Gefrierschrank die klare Aussage: Die kirchliche „Lehre ist nicht statisch“. Und er bekennt, wie gerne er das Wort des Komponisten Gustav Mahler zitiere: „Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“
Über die Autorin
Daniela Engelhard ist Leiterin des Forums am Dom in Osnabrück. Bei der Arbeit in dieser Einrichtung der Citypastoral kommt sie mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Von Erlebnissen und Themen, die sie bewegen, berichtet sie in ihren Blogbeiträgen.
Auch für pastorale Entwicklungen im Bistum Osnabrück wurde Franziskus mit seinen Botschaften ein wichtiger Impulsgeber. Bereits in seiner Regierungserklärung „Freude des Evangeliums“ (Evangelii gaudium) fordert er 2013 ein „neues Verständnis der tragenden Rolle eines jeden Getauften“ (EG 120). Und er wird nicht müde, zu betonen, dass Getaufte, Gesendete, Beauftragte und Geweihte aufeinander verwiesen seien und nur gemeinsam die frohe Botschaft bezeugen können. Er hat das Fundament dafür gelegt, dass in unserem Bistum qualifizierte Getaufte mit der Verkündigung des Wortes Gottes, mit neuen Formen von Verantwortung und Leitung z.B. als Pfarrbeauftragte, mit dem kirchlichen Bestattungsdienst und einige auch mit der außerordentlichen Taufspendung beauftragt sind.
Vielleicht hat Papst Franziskus selbst nicht geahnt, wie sehr er den Synodalen Weg in Deutschland inspiriert hat. Kostbar war uns im Forum Frauen des Synodalen Weges etwa ein päpstliches Wort aus dem Lateinamerika-Schreiben Querida Amazonia: „Die Laien können das Wort verkünden, ihre Gemeinschaften organisieren, einige Sakramente feiern“ (QA 89). Dabei hatte er ganz klar auch Frauen in lateinamerikanischen Gemeinden vor Augen. Sein Wort ist eingegangen in den Beschluss „Verkündigung des Evangeliums durch beauftragte Getaufte und Gefirmte in Wort und Sakrament“, der mit großer Mehrheit von der Synodalversammlung verabschiedet wurde.
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass kirchliche Lehre und Tradition keineswegs eine Gefriertruhe sein müssen. Sie sind etwas Lebendiges, das in der jeweiligen Situation mit ihren Herausforderungen neu zu befragen und auszulegen ist. Statt TK-Kost frisches, vitaminreiches Obst. So kommt es mir wie ein Vermächtnis vor: Papst Franziskus hat das aktuelle Heilige Jahr unter das Motto „Pilger der Hoffnung“ gestellt. Mit dem Bild der Pilgernden verbindet er Menschen, die äußerlich wie innerlich nicht erstarren, sondern in Bewegung bleiben. „Der Pilger geht aus sich selbst hinaus und öffnet sich für einen neuen Horizont, so dass er bei seiner Rückkehr nicht mehr derselbe ist und auch sein Zuhause nicht mehr dasselbe ist. Es ist eine Zeit zum Pilgern“ (Wage zu träumen, 172).
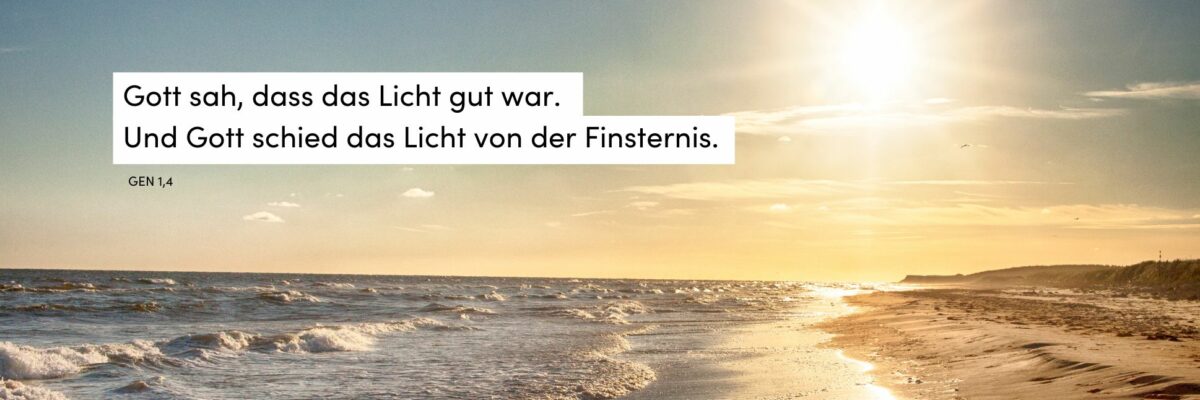
Vielen lieben Dank für diesen lebensnahen und liebenvollen Blick auf unsere gobale „Pilgergemeinschaft“. Das Pilgern gehört zu den schönsten und intensivsten Erfahrungen meines christlichen Lebens. Besonders eindrücklich finde ich die Erfahung, dass uns das Pilgern alle gleichwürdig macht, egal, welche gesellschaftliche bzw. politische Position wir bekleiden, egal welcher geschlechtlichen Orientierung, welcher Hautfarbe, welcher Kultur und welcher Generation wir zugehören. Es ist tröstlich, dass das Pilgern für alle Menschen nicht ohne Überwindung und Kraftaufwand möglich ist und Mühe bereitet.
Am Ende des Pilgerwegs steht (fast) immer die befreiende Erfahrung, dass die Mühe des Weges sich gelohnt hat, weil die Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu den Mitpilgernden neu entdeckt werden konnte. Das Pilgern wandelt – so meine Erfahrung – die eigene Perspektive hin zu einem versöhnteren und liebevolleren Umgang mit der Schöpfungswirklichkeit. Ich bin Papst Franziskus dankbar dafür, dass er die ganze Schöpfungswirklichkeit wieder in die Mitte seines Pontifikats gestellt hat. Ich hoffe, dass diese Öffnung bleibt und wir uns als Glaubensgemeinschaft immer mehr als Pilgerndes Gottesvolk entfalten können.