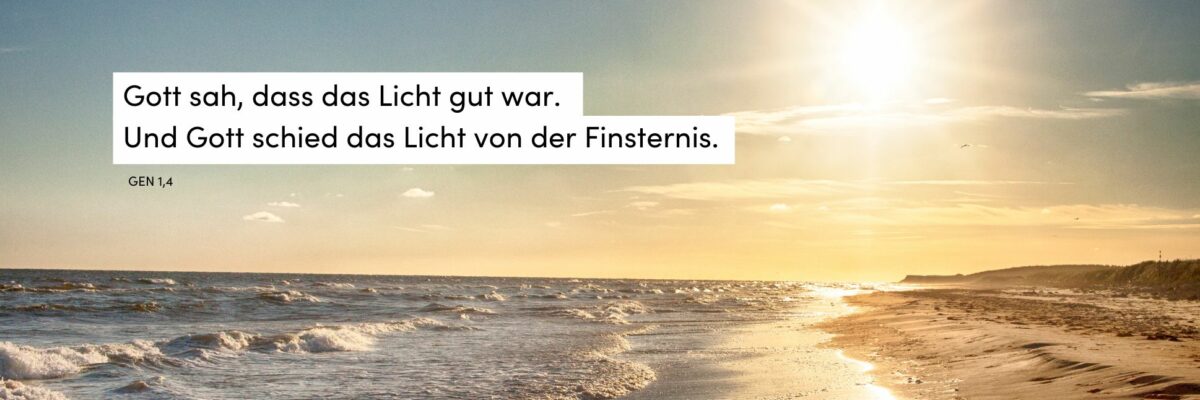Was dürfen Kinder und Jugendliche im Internet? Was sollte man im Netz auf keinen Fall tun – und was auf jeden Fall ausprobieren? Wie unterscheidet man Fakten von Fake? Was müssen Eltern wissen, bevor der Nachwuchs das erste eigene Smartphone bekommt? Und was sollten auch Erwachsene im Internet beachten? Auf dieser Seite geben zwei Experten aus dem Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Thema Medienkompetenz.

Michael Brendel, Studienleiter Digitaler Wandel und Theologie (links), und Nils Thieben, der im LWH für den Fachbereich Medien und Kommunikation zuständig ist, bilden regelmäßig Schülerinnen und Schüler zu „Medienbuddies“ aus. Im Rahmen des Projekts machen sie Teams von acht bis zwölf Jugendlichen einer Schule fit für den Umgang mit Medien. Die Medienbuddie-Teams fungieren dann an ihren Schulen als Kontaktpersonen zum Thema. Die meisten Jugendlichen hätten bereits Erfahrungen mit Cybermobbing, sexuellen Belästigungen, Falschnachrichten, Datenklau und Hassrede gemacht, erzählt Michael Brendel. „Wir möchten ihnen einen geschützten Raum bieten, in dem sie ihre Erfahrungen teilen und ihren Medienkonsum kritisch reflektieren können.“
Weitere Infos
- „Kinder sicher im KI-Zeitalter“ heißt eine Veranstaltung, die am 28. April im LWH angeboten wird. Detaillierte Infos dazu und zu weiteren Veranstaltungen rund um Kommunikation und Medien finden Sie hier.
- 130 Medienbuddies wurden bereits ausgebildet – im Sommer 2025 starten die nächsten Teams. Ausführliche Informationen dazu gibt es hier und hier.
Gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet das LWH-Team Strategien, wie sie sich und andere vor Medienmissbrauch schützen können. „Dabei geht es uns nicht darum, zu sagen: Smartphones sind schlecht – im Gegenteil“, betont Nils Thieben. „Die digitalen Medien bieten total viele Möglichkeiten: Was ich da an Kreativität ausleben kann, wie ich mich selbst ausdrücken kann, was ich von anderen lernen kann, wie ich mich mit anderen vernetzen kann, wie ich die Möglichkeit habe, den öffentlichen Diskurs mit zu beeinflussen – das soll und kann man alles nutzen, aber man sollte auch über die Risiken Bescheid wissen.“
Welche das sind und was man sonst noch wissen sollte, dazu gibt es in den Kapiteln auf dieser Seite detaillierte Informationen. Zum Lesen einfach auf das entsprechende Schlagwort klicken:
-
Tablet, Smartphone, Spielkonsole – die Knackpunkte sind immer dieselben: was, ab wann und wie lange? Glücklicherweise ist auch die Antwort auf die meisten Fragen dieselbe: Kein Gerät und keine Anwendung ist per se schädlich für die Entwicklung Heranwachsender, aber Eltern sollten ihre Kinder bei der Nutzung begleiten. Das heißt zum einen, ihnen Freiräume zu geben, zum anderen aber auch, sie für Gefahren zu sensibilisieren. Konkret empfehlen die Experten:
- Sich für das interessieren, was Kinder und Jugendliche interessiert, mit ihnen gemeinsam Spiele und Apps ausprobieren und zusammen Spaß haben mit den vielfältigen Möglichkeiten und Erfahrungen. Denn was Heranwachsende mit Medien machen, ist ein prägender Teil ihres Lebens – das darf Eltern nicht egal sein! Natürlich kann man nicht alles mitbekommen, aber die bekanntesten Apps – TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram – und ein paar Spiele – Roblox, Fifa, Minecraft, Fortnite, Brawl Stars – sollten Eltern zumindest grob kennen. Nur dann kann man gemeinsam überlegen: Was ist sinnvoll, was ist Quatsch, was ist aus welchen Gründen im Moment noch nicht erlaubt.
- Zusammen üben: Nicht jeden Link anklicken, nicht jede Kontaktanfrage annehmen, sichere Passwörter erstellen, Cookies ablehnen, Privatsphäre-Einstellungen vornehmen – all das können Kinder nur lernen, wenn sie gemeinsam mit Erwachsenen im Netz unterwegs sind, die sich damit auskennen.
- Mit Kindern über die Gefahren von Games, Chats und Social Media sprechen, zum Beispiel über Hass im Netz, Online-Sucht, Betrug und Fake News. Dabei sollten Eltern ihren Kindern vermitteln, dass sie jederzeit um Rat und Hilfe bitten können – auch und besonders, wenn sie mal Regeln gebrochen oder einen Fehler gemacht haben!
- Den Zugang sinnvoll regulieren. Dazu gehört zum Beispiel, Bildschirmzeiten und Nutzungsregeln zu vereinbaren. Außerdem sollten Schutzeinstellungen von Geräten und in Anwendungen aktiviert werden, so dass z.B. Apps nicht ohne Erlaubnis der Eltern heruntergeladen werden können oder so, dass In-App-Käufe verhindert werden. Schritt für Schritt können diese Regeln gelockert werden, denn es geht nicht nur um Kontrolle, sondern auch darum, dass Heranwachsende lernen, sich selbst sicher im Netz zu bewegen.
- Dranbleiben: Medienerziehung ist ein kontinuierlicher Prozess. Ähnlich wie Kinder Fahrrad fahren lernen – erst mit Stützrädern und mit Begleitung, dann immer weitere Strecken alleine – braucht auch das Lernen im Internet Zeit. Deswegen: Immer wieder nachfragen und mitmachen; auch für Eltern gibt’s im Internet noch einiges zu entdecken.
Linktipps für Eltern:
Linktipps für Jugendliche:
-
Möglichkeiten zum Chat gibt es inzwischen überall – bei Messenger-Diensten wie WhatsApp und Signal, aber auch auf Social Media, in vielen Apps, bei Online Games und auf Internetseiten. Im privaten und beruflichen Alltag gehören sie so selbstverständlich dazu, dass man sich gar keine Gedanken darüber macht. Das sollte man aber, zumindest wenn es um Kinder und Jugendliche geht, denn Chats können auch Probleme mit sich bringen.
- Weil im Chat oft Inhalte geteilt werden, die für Heranwachsende ungeeignet sind: Bilder und Videos in denen es um harten Sex und Gewalt geht; Links, über die Schadsoftware aufs Handy gelangt; Gewinnspiele, die reine Geldmacherei sind oder bei denen es nur ums Sammeln von Daten geht; verstörende Grusel-Kettenbriefe.
- Weil Kinder und Jugendliche in Chats vor Fremden geschützt werden müssen, die es nicht gut mit ihnen meinen. Es besteht die Gefahr des Cybergroomings: Dabei nehmen Erwachsene Kontakt zu jungen Menschen auf und geben sich als Gleichaltrige aus, um einen Kontakt anzubahnen, der Kinder und Jugendliche emotional abhängig macht und z.B. zu sexuellem Missbrauch führen kann. Experte Nils Thieben rät: „Eine Regel, die man seinem Kind schon sehr früh einprägt, ist: Steig nicht zu einem Fremden ins Auto. Das gilt auch im digitalen Raum!“ Heißt konkret: Nicht jede Kontaktanfrage annehmen, nicht mit Fremden in Einzelchats gehen und niemals mit Menschen treffen, die man nur aus dem Internet kennt, ohne es vorher jemand anderem zu erzählen.
- Weil Cybermobbing zunimmt und vor allem in Chats stattfindet. Mehr dazu hier im ausführlichen Artikel.
Linktipps für Eltern:
Linktipps für Jugendliche:
-
Soziale Netzwerke verbinden Menschen miteinander und machen einfach Spaß! Aber egal ob Instagram, TikTok oder Snapchat – hinter allen Social-Media-Plattformen steckt ein Unternehmen, das damit Geld verdient und das sollte man sich klar machen: Geld verdienen lässt sich damit nur, wenn Nutzerinnen und Nutzer so viel Zeit wie möglich auf den Plattformen verbringen. Deswegen wählen Algorithmen die Inhalte für den Newsfeed aus, die nach ihren Berechnungen interessant für Nutzerinnen und Nutzer sind – andere werden gar nicht angezeigt. Das kann hilfreich sein, birgt aber auch Gefahren, denn:
- Haben Social Media Anwendungen so ein großes Suchtpotential: Wenn man nur spannende Inhalte angezeigt bekommt, hat man keinen Grund, abzuschalten.
- Entstehen so Filterblasen, in denen die Nutzerinnen und Nutzer nur noch Inhalte sehen, die ihre eigene Weltsicht bestätigen.
- Unterscheidet der Algorithmus nicht zwischen guten und schlechten Inhalten. Das heißt: Die Algorithmen können auch in gefährliche Communitys führen. Wenn sich jemand z.B. fürs Abnehmen interessiert, bekommt er möglicherweise bald nur noch superdünne Menschen und Inhalte rund ums Thema Magersucht angezeigt.
Die Tipps der Experten lauten deswegen: Bildschirmzeit kontrollieren und zwischendurch immer mal wieder die Filterblase zum Platzen bringen, indem man bewusst nach anderen Inhalten sucht und neugierig bleibt auf andere Themen und Meinungen. Besonders für junge Menschen wichtig zu wissen: Was in den sozialen Netzwerken gezeigt wird, ist nicht die echte Welt, sondern eine Inszenierung auf einer Bühne. Menschen präsentieren hier bewusst ausgewählte Ausschnitte eines Lebens, das mit ihrem wirklichen Leben oft gar nicht viel zu tun hat.
Linktipps für Eltern:
Linktipps für Jugendliche:
-
Cybermobbing richtet sich gegen eine Person, die wegen ihres Aussehens, ihrer Persönlichkeit oder ihres Verhaltens beleidigt wird. Das Schlimme daran: Im Internet kann rund um die Uhr gemobbt werden; das Publikum kann riesengroß sein; die Inhalte verbreiten sich extrem schnell; Täter können oft unerkannt handeln und bekommen nicht unmittelbar mit, wie die Opfer reagieren, so dass die Hemmschwelle sehr gering ist.
Bei Hatespeech spielen persönliche Eigenschaften des Opfers keine Rolle. Der Hass im Netz richtet sich pauschal gegen eine gesamte Gruppe von Menschen bzw. gegen Personen, weil sie bestimmte Merkmale einer Gruppe von Menschen haben, z.B. Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft oder Religion.
Was hilft?
Melden, blockieren, löschen, anzeigen – wer von Mobbing betroffen ist, sollte sich an Eltern, Lehrpersonen oder eine Beratungsstelle wenden und sich Hilfe holen. Manchmal hilft ein Gespräch mit den Mobbern; wenn nicht, können sie auch bei der Polizei gemeldet werden, denn systematische Beleidigungen und Bedrohungen sind strafbar. Das gilt auch, wenn gegen Minderheiten gehetzt wird oder rechtsextreme Parolen und Symbole gepostet werden. Wenn möglich: Gegenrede, also klarstellen, dass Hass und Hetze nicht in Ordnung sind – das ist wichtig für die Betroffenen, aber auch für alle anderen Leute, die mitlesen.
Hilfe vor Ort:
Beratungsstellen gibt es in jeder größeren Stadt; sie können über die gängigen Suchmaschinen und Stichworte wie Cybermobbing, Cybergrooming oder Onlinesucht plus Ortsnamen gefunden werden.
-
Was Fakt ist und was Fake, ist im Internet oft gar nicht so leicht zu unterscheiden. Fünf Tipps, um verlässliche Informationen zu bekommen, gibt es hier:
- Profis vertrauen, also ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten. Alle seriösen Medien haben neben Internetseiten auch Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. Dort bekommt man verständlich und knackig aufbereitete Informationen. Achtung: Nicht alle Infos werden im persönlichen Feed angezeigt, deswegen immer wieder bewusst auf die Profile der Newsanbieter gehen!
- Mindestens eine Nachrichten-App auf dem Handy haben und regelmäßig checken.
- Vorsicht bei weitergeleiteten Bildern und News – was sagt mir mein Verstand dazu? Kann das stimmen, ist das komisch, werde ich stutzig? Woher kommt die Information – vertraue ich der Quelle? Nutzt oder schadet die Nachricht jemandem?
- Im Zweifel Google und Google Lens fragen: Wenn eine Nachricht relevant ist, findet man dazu etwas bei seriösen Medien. Wenn sie Desinformation ist, steht das oft auch schon im Netz. Bei Google Lens kann man Bilder hochladen und sich ähnliche Bilder anzeigen lassen – z.B. um nachzuvollziehen, wann ein Bild erstmals veröffentlicht wurde, denn oft werden für Fake News alte Bilder genutzt und aus dem Kontext gerissen, um eine neue Situation falsch darzustellen.
- Unabhängige Kanäle zum Faktencheck nutzen, z.B.
https://correctiv.org
https://www.mimikama.org
https://gadmo.eu
-
In vielen Endgeräten und Programmen ist künstliche Intelligenz am Werk, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer es wahrnehmen: beim Sortieren der Fotos auf dem Smartphone, beim Navi im Auto, wenn Suchmaschinen oder Streamingdienste genutzt werden. „Wir haben es mit einer Technologie zu tun, die die Menschheit nachhaltig verändern wird – das müssen wir uns klarmachen“, sagt Michael Brendel. Er sieht die Chancen der Technik: für Kunst und Kreativität, als individuelle Unterstützung beim Lernen und bei allem, was mit Sprache zu tun hat – endlich mal Versicherungsverträge oder Behördensprache verstehen, weil die KI das verständlich runterbrechen kann – aber auch für die Forschung und Wissenschaft. Im Umgang mit künstlicher Intelligenz sollte man aber auf jeden Fall zwei Dinge beachten:
- KI-Anwendungen wirken oft menschlich, sind aber bewusstseinslose Rechenmaschinen – sie analysieren und organisieren Daten, können Muster erkennen und Lösungen vorschlagen, aber sie können nicht selber denken. Chat-Bots wie ChatGPT imitieren menschliche Sprache und Emotionen, damit man sich gerne mit ihnen unterhält, aber dahinter steckt ein Computer, der mit Nullen und Einsen operiert und nicht mit Gefühlen oder menschlichen Konzepten wie Wahrheit oder Ethik.
- Persönliche Daten schützen: Bei den großen Modellen, die alle in kommerzieller amerikanischer Hand sind, weiß man nicht, was mit den Daten geschieht. Deswegen sollten personenbezogenen Daten nur sehr sparsam bzw. anonymisiert für die Nutzung von KI-Anwendungen verwendet werden.
Buchtipp:
„ChatGPT, Generative KI – und wir! Kreative Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll nutzen“ von Michael Brendel (Taschenbuch, 316 Seiten/Ebook, Edition Wortverein, 2024); weitere Infos: www.michaelbrendel.de/chatgpt