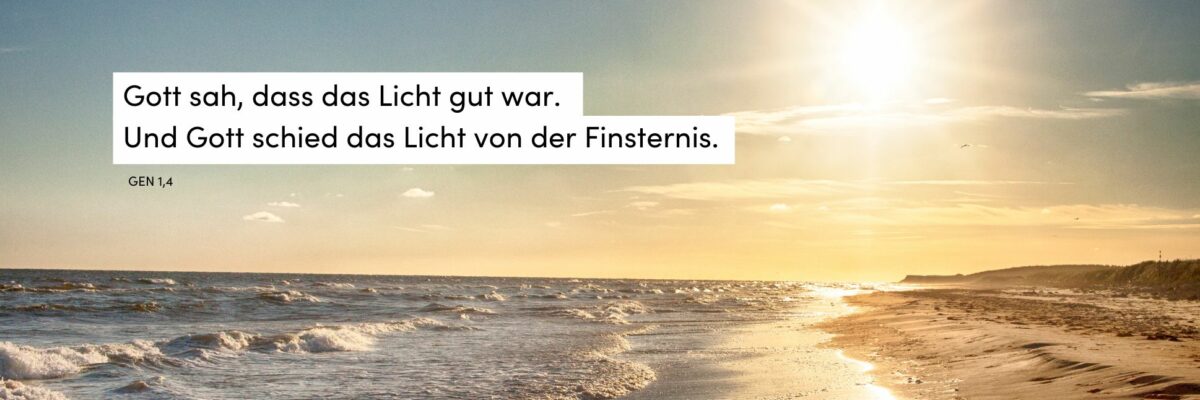Was ist der Mehrwert von Demokratie?

Warum lohnt es sich, in einer liberalen Demokratie zu leben? Josef Könning, Referent in der Katholischen Bildungsstätte Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte-Holzhausen, hat da eine ganz überraschende Antwort parat. Wer sie beherzigt, lernt viel fürs Leben – und auch für sich persönlich.
In mehreren Kampagnen geht es im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 darum, sich für die Demokratie einzusetzen. Aber was bringt es den Menschen überhaupt, wenn sie in einer liberalen Demokratie leben? Was ist der Mehrwert?
Wir können in einer liberalen Demokratie die Erfahrung machen: Ich habe ein eigenes Interesse, das seine Berechtigung hat – und andere haben das auch. Wir müssen uns auf einen Weg machen, um dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Vielleicht lasse ich mich dabei sogar von den Meinungen oder den Ansichten anderer überzeugen. Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, also ein politisches System mit Gewaltenteilung und bestimmten Grundrechten, sondern sie ist eben auch eine Lebensform, in der die Menschen den Einsatz für sie als ihre Verantwortung erkennen und in ihrem Alltag leben.
Das sich Auseinandersetzen mit anderen Meinungen kann aber auch eine ganz schöne Zumutung sein …

Klar, das ist auch eine Zumutung. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil von Demokratie, dass ich nicht darauf setzen kann, dass das, was ich jetzt unmittelbar will, so gemacht wird. Vor allen Dingen besteht die Möglichkeit, die eigenen Interessen und die Interessen der anderen in einen Zusammenhang zu bringen und auszuhandeln. Diese Erfahrung ist wertvoll, weil wir eben die Möglichkeit haben, etwas über uns selbst oder von anderen zu lernen.
Und was ist, wenn ich sage: Es läuft für mich, ich habe Job, Familie und Hobby. Und Demokratie ist anstrengend und wählen bringt auch nichts, weil sich sowieso nichts ändert. Also wenn ich mich sozusagen ins Private zurückziehe?
Ich bin mir unsicher, ob wir die Leute gewinnen, wenn wir im Einzelnen aufzählen, inwiefern sie trotzdem von der Demokratie profitieren. Ich würde eher versuchen, sie dazu zu motivieren, sich auf demokratische Prozesse einzulassen. Ich habe selbst schon öfter erlebt, dass am Anfang eher Skepsis herrscht: Ja, jetzt treffen sich hier tausend Leute mit unterschiedlichen Meinungen und wie soll daraus etwas entstehen? Das Spannende war dann immer der Prozess, der dahin geführt hat, dass am Ende etwas Gemeinsames entstand.
Weitere Infos
- Termine, Aktionen, Videos und mehr zum Thema Wahl und Demokratie gibt es hier.
Meine Schule der Demokratie war die CAJ (Christliche Arbeiterjugend). Bei den Leitungsräten, bei denen ich dabei war, konnte ich erleben, wie viel noch mit den vorher eingereichten Beschlussvorlagen passieren kann. Weil dort eben noch mal Debatten entstehen, Argumente hin und her getauscht werden und ein Antrag eine andere Gestalt bekommt. Dass es gelingen kann, unterschiedliche Perspektiven zu artikulieren und zu berücksichtigen und dass am Ende alle damit leben können, das finde ich eine sinnvolle Erfahrung.
Profitiert von der Demokratie dann nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, die ausreichend gebildet ist und auch über ein ordentliches Einkommen verfügt, das es ihr ermöglicht, sich hier einzubringen?
Das ist eine Gefahr und ein echtes Problem. Wir sehen das auch an der Zusammensetzung der Parlamente, dass bestimmte Berufsgruppen und Bildungsabschlüsse unterrepräsentiert sind. Auch im Geschlechterverhältnis oder beim Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte ist das zu beobachten. Die Ideale der Demokratie sind ja, dass jede Stimme gleich viel zählt und dass Herrschaft nicht auf Dauer einer bestimmten Person oder einer Partei oder einer bestimmten Gruppe – nicht einmal dem Volk –vorbehalten werden soll, sondern dass sie immer wieder neu besetzt werden muss. Daraus ergibt sich der Auftrag, Demokratie so zu gestalten und zu leben, dass sie immer inklusiver wird und dass sie eben nicht dauerhaft Diskriminierungsstrukturen und Barrieren aufrecht erhält, die Menschen mit vielleicht erschwerten Zugangsvoraussetzungen die Teilnahme nicht möglich machen. Das beschränkt sich nicht auf Mitbestimmung. Es geht um Teilhabe an der Gesellschaft und da stellt sich natürlich die Frage nach materiellen Voraussetzungen. Das betrifft auch unsere christlichen Überzeugungen im Kern: In den biblischen Überlieferungen haben wir eine starke Option für die Ausgeschlossenen und Marginalisierten. Diese Option verpflichtet dazu, ungerechtfertigte Schließungsprozesse zu kritisieren und für mehr Partizipation zu streiten.
Raum für Demokratie
Das Bildungshaus Haus Ohrbeck beteiligt sich an der Kampagne der Bundeszentrale für politische Bildung „Raum für Demokratie“. Neben einer kleinen Ausstellung im Untergeschoss gibt es auch ein „Demokratie-Dinner“: Es findet am Dienstag, 11. Februar, um 18 Uhr statt. Den Teilnehmenden soll dabei „Appetit auf einen lebendigen Austausch von Meinungen, Ansichten und Ideen“ gemacht werden. Neben einem dreigängigen Menu gibt es Impulse, die die Menschen miteinander ins Gespräch bringen sollen. Fragen, über die man sich austauschen kann, sind beispielsweise: Wie erleben Sie unsere Demokratie gerade? Haben Sie sich vielleicht schon mal für demokratische Ideen eingesetzt? Wie kann es Spaß machen, für die Demokratie zu kämpfen? Anmeldung unter Telefon 0 54 01 / 336-0 oder per E-Mail: info@haus-ohrbeck.de, Kostenbeitrag: 15 Euro.

Auf der anderen Seite herrscht in Autokratien oder Diktaturen meistens nur ein kleiner Kreis. Ist das aber nicht auch ein Vorteil, wenn Entscheidungen schnell gefällt werden müssen?
Schneller heißt nicht unbedingt besser. Ich kenne diese These auch aus umweltethischen Überlegungen: Einige sind der Meinung, dass angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels bestimmte demokratische Verfahren ausgehebelt werden sollten, weil das die Prozesse beschleunigen würde. Das setzt aber voraus, dass wir immer wissen können, dass bestimmte Entscheidungen in ihren Konsequenzen eindeutig gut oder schlecht oder richtig oder falsch sind. Ein Beispiel, an dem mir deutlich geworden ist, dass man immer Beteiligungsverfahren mitbedenken sollte, ist die Tesla-Fabrik in Grünheide, Brandenburg. Da ist der Prozess, auch unter Aushebelung gängiger Verwaltungsverfahren, ziemlich schnell gegangen. Die Produktion von Elektroautos ist sehr wasserintensiv; in der Region ist aber vor allem Wasser sehr knapp. Außerdem hatten viele Anwohner*innen die Befürchtung, Gefahrenstoffe könnten das Grundwasser verunreinigen. Ohne zivilgesellschaftliche und aktivistische Proteste und Eingaben wäre die Ressourcenschonung deutlich weniger berücksichtigt worden. Daran zeigt sich: Dem Ziel der CO2-ärmeren Mobilität stehen andere gewichtige Umweltauswirkungen gegenüber, die wir mitberücksichtigen müssen, weil sie potenzielle Zielkonflikte sichtbar machen. Und wie gehen wir damit um? Da braucht es partizipative Verfahren.
Gerade hat man das Gefühl, dass die liberale Demokratie immer weiter zurückgedrängt wird und autoritäre Gruppen an die Macht kommen. Hat Demokratie denn eine Zukunft?
In meinen schlechten Momenten verzweifle ich manchmal schon, aber das kommt natürlich nicht in Frage! Für mich ist es immer noch wichtig, sich für Demokratie einzusetzen und vor allem in den Zusammenhängen, in denen wir uns tagtäglich bewegen, für Demokratie zu kämpfen, sich für sie stark zu machen.
Müssen wir als Gesellschaft Demokratie also wieder mehr einüben?
Ja, es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten, sich zu organisieren oder zu engagieren: Im Alltag diskutieren und debattieren. Sich selbst informieren und kritisch prüfen, woher die Informationen stammen, die zum Beispiel in Chatgruppen geteilt werden. Demonstrieren, in Vereine gehen oder in Initiativen mitarbeiten. Sich in Kirchengemeinden einbringen und die vorhandenen demokratischen Prozesse mitgestalten. Parteipolitisches Engagement, sich für ein Mandat in den Kommunen aufstellen lassen.