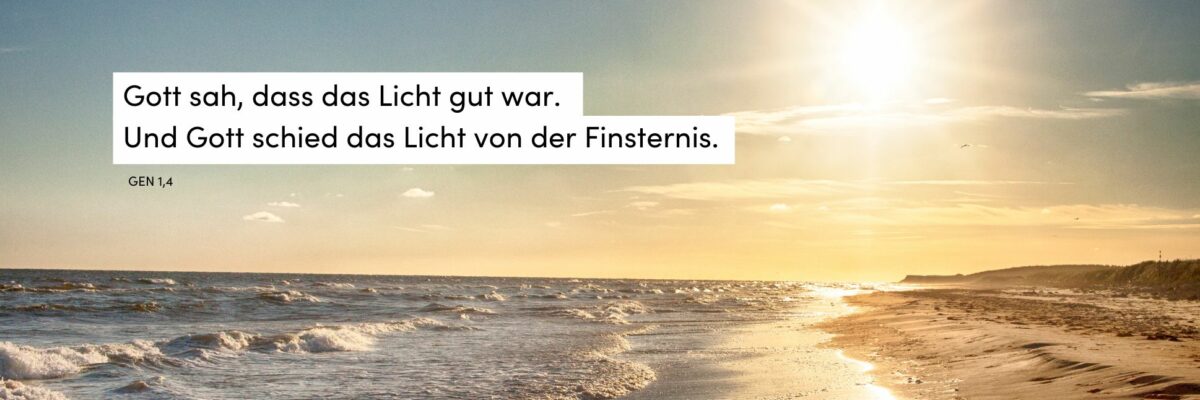Die spirituelle Dimension von Corona

Lockdown, Impfen und AHA – alles bewährte Mittel in der Corona-Pandemie. Doch wo bleibt eigentlich Gott? Was hat er mit Covid 19 zu tun – und kann der Glaube an ihn bei der Bewältigung dieser Krise helfen? Pater Franz Richard, Franziskaner und Geistlicher Begleiter im Bistum Osnabrück, hat sich mit diesen und weiteren Fragen zur spirituellen Dimension von Corona auseinandergesetzt. Im Interview spricht er über Corona-Müdigkeit und Hoffnung, übers Impfen und Beten und über kleine Botschaften Gottes im Alltag.
Zwei Jahre lang schon bestimmen das Corona-Virus und seine Folgen unser Leben und noch immer ist kein Ende abzusehen. Wie kann man es schaffen, trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren?
Hoffnung, die erfüllt ist, ist keine Hoffnung mehr. Aber das Nicht-Erfülltsein der Hoffnung auszuhalten, ist hart. Unsere Hoffnung, die im vergangenen Sommer schon in Richtung Erfüllung ging, ist schwer enttäuscht worden. Die Pandemie ist nicht zu Ende. Im Gegenteil: die jetzt durch die Omikron-Variante verschärfte Lage führt zu gereizter Corona-Müdigkeit. Ich spüre die Aggression um mich herum, gegen die immer wieder neu auftauchenden Varianten des Virus, die lästigen Masken und die beschlagenen Brillen und viel tiefer: gegen die Not des Lebens. Das alles ist eine Herausforderung an unsere Hoffnung. Aber genau das macht die Hoffnung aus: auf eine Besserung der Zustände zu warten und dafür zu arbeiten.
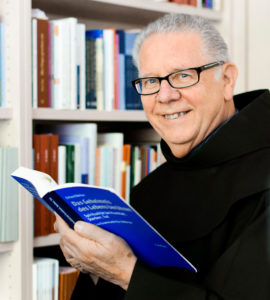
Ein Zweites: Wir erleben in dieser Pandemie etwas, was wir nicht mehr so stark gewohnt waren, nämlich die Konfrontation mit der Unverfügbarkeit der Welt. Wir waren es gewohnt, dass wir Probleme mit unserem Wissen, unserer Technik und unserer Erfahrung lösen können. Nun müssen wir erfahren, dass das nicht so schnell geht, wie gewohnt. Klar, wir können nur dankbar sein, das so schnell ein Impfstoff gefunden wurde. Aber die neuen Varianten stellen uns vor neue Herausforderungen. Wir werden sehr geprüft.
Ein Weiteres: Ich staune über die Anstrengungen vieler Menschen, sich in diesen Entwicklungen um Auswege aus der Krise zu bemühen. Ich staune über den Mut vieler Menschen, die sich davon nicht irre machen lassen und die versuchen, ihren Alltag, so gut es geht, normal zu bewältigen. „Tue die Dinge, die du tun kannst, so gut es geht“, sagt eine alte Weisheit. Das hilft. Und: Fixiere dich nicht total auf das Virus, erhalte dir Freiräume in den begrenzten Möglichkeiten. Wir sollten die Realität nicht verhübschen und nicht verteufeln – sie ist einfach da. Wir müssen sie zulassen – im Angesicht Gottes. Das ist für mich Spiritualität in diesen Zumutungen.
Was ist mit denen die bereits völlig verzweifelt sind, weil sie aufgrund der Pandemie einen geliebten Menschen verloren haben – oder ihren Arbeitsplatz, ihre Lebensgrundlage?
Diese Menschen brauchen unser Mitgefühl, unser Mit-Leid, in dem Sinne, dass wir wirklich mit ihnen leiden. Es ist eine Realität, dass Menschen die Hoffnung verlieren, dass sie keine Kraft mehr haben. Das ist anzuerkennen. Davor darf man nicht weglaufen. Das ist nicht leicht. Immer wenn der Impuls entsteht, wegzulaufen, gilt für mich das, was ich für die Trauerbegleitung gelernt habe, einen Drei-Schritt zu üben: „Innhalten, Abstand halten, aushalten“. Es ist schwer auszuhalten, dass Menschen in der Pandemie Angehörige verloren haben und ihnen in den letzten Stunden nicht beistehen konnten. Wie furchtbar! Da helfen keine frommen Sprüche, da hilft nur, da zu sein und das Elend mit zu tragen. Der Theologe Johann Baptist Metz spricht von der Kraft zur „compassion“ als einem Kennzeichen des christlichen Glaubens. Das englische Wort drückt das tiefer aus als unser manchmal zu oberflächlich gebrauchtes Wort „Mitleid“. Wenn ich diese Haltung der „compassion“ lebe, zeigt sich vielleicht ein kleiner Abglanz dessen, was mit dem Gottesnamen „Jahwe“ – „Ich bin der Ich-bin-da“ gemeint ist. Gott ist da, auch und gerade in der Not, das hat uns Jesus Christus auf seinem Weg zum Kreuz gezeigt.
Es ist eine altbekannte Frage, die sich aber auch jetzt wieder neu stellt: Wie kann Gott so etwas wie diese Pandemie zulassen? Wo ist er in all dem Leid?
Weitere Infos
- Mit Beharrlichkeit und Hoffnung durch die Krise – hier gibt’s Tipps von der Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung.
- Angebote zur geistlichen Begleitung – nicht nur in der Krise – finden Sie hier.
- Weitere Infos zu Corona im Bistum Osnabrück gibt es auf dieser Seite.
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil sie mein Bild nicht nur vom „lieben Gott“, sondern auch von einem „liebenden Gott“ auf die Probe stellt. Naturkatastrophen, Seuchen, Unglücke führen dahin, zu fragen: Warum hat Gott die Welt so gemacht? In dieser Perspektive wird er mir fremd. Die Mystikerin Mechthild von Magdeburg hat bereits im 13. Jahrhundert den Begriff der „Gottesfremdung“ geprägt, der Entfremdung von Gott, die sie ohne Halt, ohne Trost, ohne Hoffnung zurückließ. Im Weiteren beschreibt sie aber, wie die Zweifel im Glauben und die Ferne Gottes sie letztendlich bereichert haben: „Nun verfährt Gott wunderbar mit mir, da mir seine Entfremdung lieber ist als er selbst. Das bedeutet aber auch, dass ich den Schmerzen einer langen Wartezeit ausgesetzt bin.“ Man kann diese Erfahrung vielleicht mit einem Liebespaar vergleichen, das längere Zeit voneinander getrennt ist: Sie werden sich vermissen und sich vielleicht gerade deswegen nah sein – im Vermissen wird eine intensive Beziehung deutlich. Die scheinbare Abwesenheit Gottes in der Pandemie fordert heraus. Sie ist eine Prüfung: Wie kann ich meinen Glauben an Gott so weiterleben? Der Dichter Friedrich Hölderlin hat es mit diesen Worten gesagt: „Nah ist und schwer zu fassen der Gott.“ Oder wie der Theologe und Schriftsteller Christian Lehnert schreibt: „Der Gott, den es nicht gibt, in mir ein dunkler Riss, ist meiner Seele nah, so oft ich ihn vermiss.“
Auf jeden Fall möchte mich vor der Aussage verwahren, dass die Pandemie eine Bestrafung Gottes ist, weil wir oberflächlich und gottfern gelebt haben. Solche Behauptungen kann ich nicht mit unserem Glauben an Gott verbinden.
„Ich brauche mich nicht impfen zu lassen, denn ich glaube an Gott und daran, dass er mich beschützt!“ – Wie stehen Sie zu solchen Aussagen?
Gott handelt nicht ohne uns. Bildlich gesprochen: Wenn der Karren im Dreck liegt, muss ich anfassen und schieben, um ihn wieder raus zu bekommen. Dabei darf ich natürlich auch auf Gott vertrauen und darauf, dass er mir hilft. Aber wenn ich die Hände in den Schoß lege, nichts tue und glaube, Gott allein muss helfen, bleibt der Karren im Dreck stecken. Gott hat uns Menschen die Freiheit gegeben, das Mögliche zu tun. Das heißt in der aktuellen Corona-Situation: die AHA-Regel zu beachten und sich gegen Corona impfen und boostern zu lassen. Ich vertraue den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass ich mich durch die Impfung vor einem schweren Verlauf schützen kann und so mithelfe, dass ich nicht anderen schwer Erkrankten – Schlaganfallpatienten, Unfallopfern, Menschen mit Krebs – ein Bett auf der Intensivstation wegnehme. Sich impfen zu lassen ist für mich ein Zeichen der Solidarität und der christlichen Nächstenliebe.
Wie kann mein Glaube mir in dieser extremen Situation helfen?
 Natürlich kann beten helfen. Es kommt häufig vor, dass Menschen mich darum bitten, für sie zu beten. Das ist für mich ein Akt der Solidarität. Es tut mir gut, wenn ich weiß, dass andere an mich denken und für mich beten. Wenn ich bete, gebe ich Macht ab und mache mir bewusst, dass ich nicht allein Herr der Lage bin. Ich begebe mich in einen größeren Horizont und weite meinen Blick. Ich gebe, was mich beschäftigt, an jemanden ab, an den ich glaube – in der Hoffnung, dass der mich unterstützt. Außerdem helfen mir Gebet und Glaube, wach zu bleiben für die Herausforderungen der Zeit.
Natürlich kann beten helfen. Es kommt häufig vor, dass Menschen mich darum bitten, für sie zu beten. Das ist für mich ein Akt der Solidarität. Es tut mir gut, wenn ich weiß, dass andere an mich denken und für mich beten. Wenn ich bete, gebe ich Macht ab und mache mir bewusst, dass ich nicht allein Herr der Lage bin. Ich begebe mich in einen größeren Horizont und weite meinen Blick. Ich gebe, was mich beschäftigt, an jemanden ab, an den ich glaube – in der Hoffnung, dass der mich unterstützt. Außerdem helfen mir Gebet und Glaube, wach zu bleiben für die Herausforderungen der Zeit.
Dazu gehört für mich auch, wach zu bleiben für die kleinen Unverfügbarkeiten des Alltags – denn Unverfügbarkeiten stoßen uns ja auch im positiven Sinne zu! In einem Sonnenstrahl nach dem Regen, in einer Begegnung, einem Wort kann mich die größere Wirklichkeit überraschen, trösten, glücklich machen. Der Theologe Johann Baptist Metz hat einmal gesagt: „Die kürzeste Definition von Religion ist: Unterbrechung.“ Solche Unterbrechungen werden mir geschenkt. Einige Unterbrechungen kann ich selbst gestalten, durchs Innehalten im Alltag, durch Augenblicke, in denen ich mir bewusst mache, dass ich lebe, dass ich atme. Oder durch kleine, aber wichtige Rituale, z.B. das Anzünden einer Kerze im Gedenken an die Menschen, die in Not sind. Für diese kleinen positiven Unterbrechungen und Überraschungen gilt es, aufmerksam zu bleiben, sie als kleine Wunder wahrzunehmen und als Botschaften Gottes in meinem Alltag aufzunehmen.
Haben Sie eine Idee für eine praktische Übung, die Kraft für den Alltag geben kann?
Ein einfaches und zugleich tiefes Ritual ist es, sich am Morgen mit dem Kreuzzeichen zu segnen. Dabei nehme ich das Geheimnis, das wir Gott nennen, hinein in die Höhe und Tiefe und Breite des Lebens. Ich persönlich praktiziere folgendes Ritual: Wenn ich aufgestanden bin, gehe ich draußen vor die Tür oder ans offene Fenster und stelle mich in den Tag. Ich hebe die Arme zur Seite mit den Handflächen nach unten und überleg: „Was kommt heute auf mich zu? Was hängt heute an meinen Armen?“.
ann drehe ich die Handflächen mit ausgebreiten Armen nach oben. In dieser Haltung kann ich das, was auf mich zukommt, besser tragen. Danach hebe die Hände und Arme hoch zum Himmel – ich vertraue Gott alles an und bitte Gott um seinen Segen für mich, für die Menschen und Situationen, die mir im Laufe des Tages begegnen. Zum Schluss lasse ich die Hände sinken, falte sie vor meinem Körper und nehme die Kraft aus dem Himmel mit hinein in meinen Tag. Ich breite die Arme aus und lasse sie sinken und lege damit den erbetenen Segen auf die Menschen und Situationen. Dieses Rituale beschließe ich mit dem Kreuzzeichen.