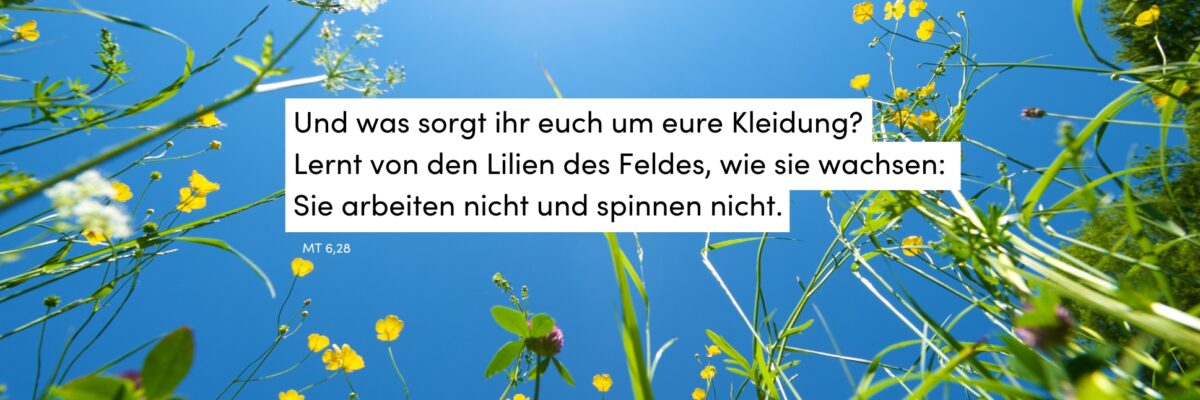„Ich bin angekommen“

Kristian Pohlmann aus Oesede ist 27 Jahre alt. Am Pfingstwochenende 2018 wurde er zum Priester geweiht. Schon früh spürte er, dass er zu Leben und Arbeit in der Kirche berufen ist. Im Interview erzählt er seine Geschichte.
Herr Pohlmann, wollten Sie schon immer Priester werden?
Ja und nein. Grundsätzlich hat sich das schon mein ganzes Leben lang abgezeichnet. Aber ich unterscheide da ganz deutlich zwischen der Zeit im Kindergarten und dem, was da über die Jahre konkret gewachsen ist. Im Kindergarten habe ich mir selbst Decken umgehängt und den Mann „da vorne“ in den bunten Gewändern nachgespielt, weil ich das so toll fand. Die Entscheidung Priester zu werden, habe ich aber natürlich nicht aufgrund der schönen Gewänder gefällt. In der Grundschule hatte ich auch andere Berufswünsche.
Was wollten Sie als Kind werden?
Also schon ganz ursprünglich wollte ich Pastor werden, dann auch mal Polizist oder während der Grundschule auch Grundschullehrer.
Wie ging es dann mit ihrer Berufungsgeschichte weiter?
Direkt nach der Erstkommunion wollte ich unbedingt Messdiener werden. Eine andere Option gab es für mich gar nicht und ich konnte es überhaupt nicht abwarten. Was damals für mich ganz schön war, war, dass mein enger Freundeskreis, mit dem ich auch heute noch viel zu tun habe, auch zu den Messdienern gegangen ist.
Wann wussten Sie, dass Sie Priester werden wollen?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass es auf einmal für mich diesen Aha-Moment „Jetzt will ich Priester werden“ gab. Das war vielmehr ein Prozess. Erst war ich Messdiener, dann wurde ich Gruppenleiter, später wurde ich angesprochen, ob ich nicht auch mal Lust hätte, im Gottesdienst einige Lesungen zu übernehmen. Dazu habe ich auch noch angefangen Orgel zu spielen und habe das häufig in Oesede im Altenheim gemacht. Dadurch bekam ich viel Kontakt zu älteren Menschen. Das zeigte mir, dass ich mir einen Beruf wünsche, in dem ich mit Menschen aus allen Altersschichten zu tun habe. Jugendarbeit ist meins, aber genauso Seniorenarbeit. Dabei war mir dann auch schnell klar, dass ich mir durchaus einen Beruf in der Kirche vorstellen könnte.
Wir hatten in Oesede damals einen sehr guten Kaplan, Hartmut Sinnigen. Der kam frisch zu uns, als ich gerade Gruppenleiter wurde und unternahm sehr viel mit uns. Fahrradtouren im Sommer, Kanutouren und viele andere Aktivitäten, bei denen Kirche einfach noch mal ganz anders erlebbar und greifbar wurde. Herr Sinnigen war damals wirklich ein Glücksgriff für mich. In ihm hatte ich einen sehr guten Begleiter, mit dem ich einige sehr gute Gespräche über meine beruflichen Vorstellungen geführt habe. 2010 bin ich dann ins Studium gegangen.
Was bedeutet Berufung für Sie?
Berufung ist für mich das, was ich selber nicht machen oder herstellen kann. Wenn ich von meiner Berufung erzähle, stoße ich dabei auch immer wieder an gewisse Grenzen, weil ich das dann selber nicht mehr weiter begründen oder erklären kann. Die Frage habe ich mir selber auch gestellt: Warum will ich jetzt unbedingt Priester werden? Weil ich mit Menschen zusammenarbeiten will. Weil ich mich freue, den Menschen Sakramente zu spenden – Taufe, Beerdigung, Trauung. Ich habe mit Menschen in allen Lebenslagen zu tun und kann sie begleiten. Und dennoch gibt es da immer einen Punkt, ab dem es unerklärlich ist und mir die Worte fehlen.
Am besten beschreiben kann ich es wohl mit der Situation, als mein alter Heimatpfarrer Dieter Woldering vor drei Jahren starb. Er war weit über 80 und war mehr als 60 Jahre lang Priester gewesen. Ein paar Tage vor seinem Tod besuchte ich ihn noch im Krankenhaus. Und dann sagte er zu mir etwas, das für mich wunderschön ausdrückt, was Berufung heißt: „Min Jung, du weißt, du brauchst nicht Priester werden, weil ich das gerne möchte. Aber wenn du es hier spürst“ – und dabei zeigte er auf sein Herz – „und du sagst, da ist es richtig, dann mach es. Und ich sage dir jetzt nach über 60 Jahren, dass ich darauf gehört habe. Und es war richtig.“
Vielleicht kann man das ein bisschen mit Verliebtsein vergleichen. Das ist auch ein Gefühl, das man nicht bis ins letzte erklären kann. Aber das ist bei anderen Berufen genauso. Ich habe in Trier mal einen Weinhändler getroffen, der mir erzählte, dass er in seinem vorigen Beruf als Makler zwar mehr verdient hätte, er aber jetzt in seinem Leben richtig angekommen sei, seitdem er den Weinbetrieb von seinen Schwiegereltern übernommen hat. Und genauso geht es mir nun nach dem einen Jahr in Bremen im Diakonat. Ich bin angekommen.
Wie haben Sie gespürt, dass Sie berufen sind?
Während des Studiums gab es für mich auch sehr schwere Zeiten. Wir hatten einen sehr schweren Schicksalsschlag in der Familie, aber während dieser Zeit hat mich der Glaube doch sehr getragen. Er hat mir Halt gegeben. In dem Moment habe ich das gar nicht so richtig gemerkt. In bin in der Zeit zwar jeden Tag zur Messe gegangen, aber ich habe innerlich doch eine relativ große Leere verspürt. Doch im Nachhinein habe ich gemerkt, wie gut mir dieser tägliche Messbesuch getan hat und wie wichtig mir meine Beziehung zum Glauben und zu Gott ist. Diese Beziehung ist für mich existenziell, sie trägt mein Leben. Letztes Jahr in der Nacht vor der Diakonweihe habe ich noch gegrübelt: Dein Leben ändert sich eigentlich nicht, du hast darauf lange hingearbeitet, aber im Grunde sagst du morgen noch einmal „ja“ zu allem. Aber was ist, wenn es das jetzt nicht ist? – Da hatte ich schon Bauchschmerzen. In der Gemeinde sind meine innerlichen Gefühle dann doch wieder voll bestätigt worden: Ich bin genau da, wo ich hinwollte. Das macht mir einfach Freude. Sicher, die Arbeit ist auch manchmal schwierig. Auch gerade, wenn man zum Beispiel jüngere Menschen beerdigen muss. Trotzdem, dieses Leben und dieser Dienst machen mich glücklich. Einfach für die Menschen da zu sein, ihnen etwas mitgeben zu können.
Was macht Ihnen denn bisher am meisten Spaß?
Das schönste sind tatsächlich Taufen und Beerdigungen, auch wenn bei letzterem „schön“ erst einmal komisch klingt. Taufen sind einfach unheimlich schön: Neues Leben ist geboren und ich darf sie nun in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. Das sind immer sehr lebendige Feiern, auch sehr individuell. So wie jedes Kind unterschiedlich ist, ist auch jede Taufe unterschiedlich. Aber auch gerade bei Beerdigungen erlebe ich bei den Menschen während meiner Besuche eine sehr große Dankbarkeit, trotz aller Trauer und Ausweglosigkeit. Es ist schön, dass ich ihnen dann auch Trost geben kann.
Weitere Infos
- Auch Thomas Wirp wurde am Pfingstwochenende 2018 zum Priester geweiht – hier lesen Sie seine Berufungsgeschichte.
- Berufen fühlt sich auch Sr. Josefine – hier erzählt sie im Interview, warum sie sich mit 30 Jahren für ein Leben im Kloster entschieden hat.
- Sie interessieren sich für einen pastoralen Beruf? Bei der Diözesanstelle „Berufe der Kirche“ gibt es weitere Infos!
Was war auf Ihrem Weg bisher die größte Herausforderung?
Das war tatsächlich die Situation im persönlichen Umfeld mit Todesfällen konfrontiert zu sein, mit denen man nie so gerechnet hätte. Dinge, wo man dann doch noch mal seinen Glauben hinterfragt und man ganz neu an ihn herangehen muss. Meine Oma ist damals an Krebs erkrankt. Vorher war immer alles gut. Wir hatten nie solche Fälle in der Familie. Natürlich hörte man mal davon, aber es ist doch noch mal etwas anderes, wenn man selber davon betroffen ist und das ganze hautnah erlebt. Ich glaube, so naiv habe ich vorher nicht geglaubt, aber da merkt man dann eben doch noch mal verstärkt: Auch wenn ich jetzt das Vater Unser bete, davon wird Oma nicht wieder gesund. Das war für mich die Herausforderung, in dieser Situation das Gebet und den Glauben noch einmal ganz neu zu entdecken. Was kann er mir jetzt in dieser Situation geben? Das war eine Herausforderung, das dauerte. Aber auch einfach die Klage vor Gott zu bringen. In dieser Zeit habe ich die Psalmen noch mal sehr liebgewonnen. Durch die Krankheit meiner Oma habe ich gelernt, die Psalmen der Traurigkeit, der Angst und der Krankheit auch zu beten. Früher habe ich immer gesagt, wenn es mir doch gut geht und ich glücklich bin, wieso soll ich denn dann abends so ‘nen Psalm beten wie: „Ach Herr, die Freunde hast du mir entfremdet, mich in Abscheu ausgesetzt“? Da sagte mir ein Priester einmal damals zu Beginn des Studiums: „Bete es stellvertretend für die Menschen in der Welt, denen es vielleicht gerade schlecht geht.“ – Mittlerweile kann ich das, weil ich mich inzwischen in sie hineinversetzen kann.
Entdecken Sie im Moment auch noch neue Sachen für sich in ihrem Glauben?
Schon, ja. In der Kirche tendiert man ja dazu, sich abzugrenzen: Das hier sind die Linken, das die Rechten, der hier macht es genau richtig und der macht es ganz anders, aber ich habe meine Meinung, und so weiter. Dann lernte ich vor drei Jahren einen Priester kennen, der selber lateinische Messen liebte, aber anderen Menschen, Meinungen und Ansichten gegenüber auch sehr offen war und alle Menschen, auch Kollegen, erst einmal so annahm, wie sie sind. Und das ist jetzt auch in Bremen noch mal verstärkt gewachsen. Ich hatte auf der einen Seite die ganz, ganz Strengen, für die wirklich alles ganz korrekt sein musste, so wie es irgendwo geschrieben steht. Dann bekam ich in Bremen in der Gemeinde aber auch Kontakt zu Menschen, die eine ganz moderne Art von Gottesdienst einforderten, freiere Hochgebete wollten. Gleichzeitig gab es auch noch die, die einfach den Mittelweg gehen wollten. Aber all diese verschiedenen Ausrichtungen konnten in Bremen wunderbar miteinander existieren und leben. Als Diakon und Seelsorger war ich in der Gemeinde natürlich für alle Gruppen zuständig. Da ist für mich noch mal die Erkenntnis gewachsen, wirklich alle so anzunehmen, wie sie sind, und dass daraus wirklich auch noch ein fruchtbarer Austausch und Dialog werden kann. Da hat sich für mich auch noch mal gezeigt, was katholisch heißt: „allumfassend“.
Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre Entscheidung Priester zu werden reagiert? Offensichtlich haben Sie sich ja schon früh mit diesem Thema beschäftigt.
Am Gymnasium hatte ich relativ schnell den doch recht bezeichnenden Spitznamen „Klassenpapst“ weg. Ich habe das aber lange geleugnet. Ich wollte das noch gar nicht so zugeben, dass ich mit dem Gedanken spiele. Dann hatte ich mich aber irgendwann auch beim Bistum beworben und teilte das meinem engeren Freundeskreis mit. Die fünf Jungs, die ich teilweise schon seit dem Kindergarten kenne, sagten alle: „Gott sei Dank! Alles andere hätte dich auch unglücklich gemacht.“ Auch in der Familie, ob von den Eltern oder Großeltern, meine Entscheidung ist immer mitgetragen worden. Sicher kam da auch mal die ein oder andere Nachfrage, denn das ist natürlich eine ganz andere Lebensform als die, die man sich für seine Kinder oder Enkel so vorstellt. Aber ich hatte trotzdem immer Rückendeckung, sie haben immer alle zu mir gehalten.
Auch wenn Sie keinen richtigen Aha-Moment auf Ihrem Weg hatten, was hat Sie schon so früh am Priesterberuf fasziniert?
Als Kind kann ich es nicht sagen. Aber später… ja, vielleicht gab es doch ein kleines Aha-Erlebnis, was jetzt aber vielleicht nicht direkt so ausschlaggebend war. Ich erinnere mich an eine Gruppenleiterrunde, vor der mich unsere Gemeindereferentin kurz vorher ganz heiser anrief und fragte: „Ich bin krank, kannst du die Gruppenleiterrunde übernehmen?“ – „Ja, gut“, dachte ich. Oder nein, nichts ja gut! Ich war damals 16 und vielleicht erst ein halbes Jahr lang Gruppenleiter. Wie sollte ich das denn schaffen? Aber sie sagte überzeugt: „Doch, du kannst das wohl.“ Also saß ich dann kurz darauf in dieser Gruppenleiterrunde und merkte auf einmal: „Ja, das ist es. Das passt, das ist stimmig.“ Da ist für mich dieser Wunsch oder die Erkenntnis mit einem Mal hochgekommen, dass es doch eine Arbeit in der Kirche und eine Arbeit mit Menschen sein soll.
Was möchten Sie anderen möglicherweise Berufenen mit auf den Weg geben?
Die Frage ist ja immer, warum sich heutzutage so wenige Leute bewerben oder so wenige Priester werden. Ich glaube, dass die Berufung in ganz vielen schlummert. Und ich möchte einfach dazu ermutigen, es einfach auszuprobieren, wenn man in seinem Inneren etwas spürt. Sucht einfach den Kontakt, zum Beispiel beim PWB, oder sprecht in der Heimatgemeinde einfach den Pastor, den Kaplan oder die Gemeindereferenten an, einfach eine Person, der man vertraut, um zu erzählen, was man sich vorstellen könnte. Und dann ist das auch kein Beinbruch, wenn man nach zwei, drei Jahren merkt, dass es doch nicht der richtige Weg für einen ist. So offen ist unsere Gesellschaft heute dann ja wohl auch schon. Einfach mutig sein und den Schritt wagen, es auszuprobieren. Es ist einfach wichtig, mit einer großen Offenheit und Barmherzigkeit auf die Menschen zuzugehen. Damit können wir auch in der Zukunft gut weiter vorangehen.